|
|
| Die
Grabung von
1989/90 bestätigte die Feststellung von Ernst Krebs, die
Kapelle
sei auf den Fundamenten eines römischen Vorgängerbaus
errichtet, korrigierte aber seine Vermutung, es handle sich
um
ein römisches Heiligtum. Die Grabung und vor allem die
anschließenden Restaurierungsarbeiten an den Wänden
brachten
die Gewissheit, dass nicht nur die Fundamente der Kapelle, sondern
große Teile des aufgehenden Mauerwerks original
römisch und
Teile des Herrenhauses einer villa rustica aus dem 2. Jh. n. Chr. sind.
Die eingehende Erforschung des Mauerwerks bereicherte unser Wissen um
zahlreiche Details römischer Bauweise. Noch aber konnten
zahlreiche Fragen wie die räumliche Ausdehnung nach Osten
nicht
beantwortet werden. Erst das Einverständnis der Eheleute
Arnold
ermöglichte 1996 eine Anschlussgrabung nach Osten,
die
konkrete Anhaltspunkte über die räumliche Ausdehnung
der
Frontseite und erste Hinweise auf Vorgängerbauten gab. Diese
Außengrabung ermöglichte es Herrn
Knöchlein,
der die
Grabung auch vor Ort begleitete, den aktuellen Kenntnisstand in einer
verständlichen Skizze zusammen zu fassen. |
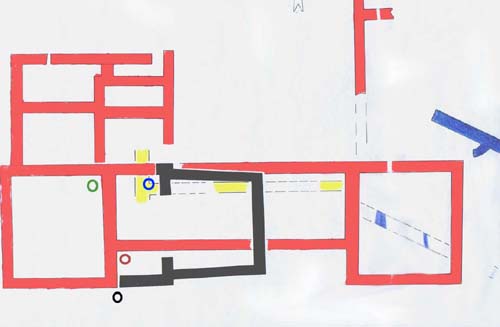 |

°Teil
des von Süd nach Nord verlaufenden Innenfundaments

°Die
Fortsetzung des bereits von Ernst Krebs im Außenbereich
östlich der Kapelle entdeckten Fundaments wurde bei
der Grabung in der
nordöstlichen Ecke des Kapellenschiffs und im Chor
festgestellt.
Sie ist im Zusammenhang mit einem Vorgängerbau zu sehen
|

Westlicher Teil der Porticusfundamente
während der Ausgrabung
|

°Freigelegte
Porticusfundamente im Anschluss an den westlichen Eckrisaliten
|

°Die
vertikale Zaesur zwischen dem westlichen Eckrisaliten und der nach
Osten fortgeführten Erweiterung des Umbaus von 956 ist
deutlich sichtbar
|

Das Foto zeigt den typischen Aufbau des
römischen Mauerwerks an der Georgskapelle. Auf den gewachsenen
Boden wurde eine massive Steinstickung gebracht, die durch 2 Lagen nur
grob behauener Quader abgedeckt war. Auf dieses solide Fundament wurde
das aufgehende Mauerwerk mit handlichen Steinquadern aufgemauert
|
|
|
Innenputz
|
Durch Rillen und Schraffierungen präparierte Ziegel wurden mit
der
glatten Seite auf die Innenwände aufgemauert und sollten dem
mehrschichtigen Innenputz einen besseren Halt verleihen (vgl.
Jens Dolata, Technisch versiertes Handwerk aus dem römischen
Mainz, Arch. in Rh-Pfalz 2003, S. 48/49)
|
 |
Etliche geriffelte und teilweise noch
putzbehaftete Bruchstücke
von Wandziegeln und zahlreiche, relativ kleine Reste des Innenputzes1),
die sich im Abraum aus dem Kapelleninnern fanden, geben einen Hinweis
auf die Wandgestaltung des quadratischen Innenraums. Danach
lässt
sich eine Wandfläche rekonstruieren, die insgesamt
großflächig mit einer harten Kalkschicht
überzogen war
und durch vielfältige schmale und breitere , meist
rötliche
Linien in rechteckige Felder eingeteilt war. Ein Befund aus der
Römervilla von Ahrweiler, wie er im Führer (H.
Fehr,
Roemervilla, S. 60) wiedergegeben wird, vermittelt einen
Eindruck.
Daneben aber fanden sich Putzstücke mit vielfarbigen kleinen
Spritzern2),
die, wie der 2. Beleg aus Ahrweiler, a.a.O. S. 61 zeigt, wohl im
Sockelbereich aufgebracht waren.
Durch die Aufmerksamkeit der Grabungsmannschaft wurde ein
kleines, kalkweißes Putzstück mit der Ritzzeichnung
eines
Kindes entdeckt. Ein Wagenlenker treibt ein Pferd an. Eine Zypresse
deutet sogar die Landschaft des fernen Italien an.
|
  |

Durch
schmale und breitere Linien in
Quadrate/Rechtecke aufgeteilte Wandfläche aus der
Römervilla Ahrweiler, wie sie auch für
Heidesheim
anzunehmen ist.
|

Durch Farbspritzer markierter
Sockelbereich unter einem rot gefassten Feld. (Römervilla
Ahrweiler)
|

Das im Original schmutzig weiße Putzstück wurde
farblich verändert, um die Ritzzeichnung hervorzuheben. |
|
Aussenmauern
|
|
Das aufgehende Mauerwerk
des
Haupthauses bestand/besteht durchgehend aus sorgfältig
behauenen,
handlichen Kalksteinquadern, die - als Bruchsteine am nahen Rabenkopf
gebrochen - erst vor Ort behauen und vermauert
wurden. Eine
Schicht von Steinabschlägen, die längs der
Südwand des
östlichen Eckrisaliten gefunden wurde, belegt diesen
Arbeitsablauf1).
Die Mauern des Gebäudes wurden anschließend so
verputzt,
dass die einzelnen Quader jeweils nur angeputzt wurden und ein Kern der
behauenen Kleinquader (die in der Länge variierten, im Schnitt
aber konstant 13 cm hoch waren,) sichtbar blieb2).
Um die
Quaderstruktur des Mauerwerks zu unterstreichen, wurde in den noch
feuchten Putz eine Fuge um die Quader gedrückt, die
anschließend mit Mineralfarbe leuchtend rot
eingefärbt
wurde. An der Südwand haben sich trotz aller
Witterungseinflüsse über 1800 Jahre Teile dieser
Originalausmalung erhalten3),
ein weiteres
bemerkenswertes
Zeugnis qualitätvoller Arbeit.
|
 |

Eines von mehreren
Pfostenlöchern des Baugerüsts, das zum Aufmauern der
oberen
Mauerpartie aufgestellt worden war. Die vom Gerüst herab
fallenden
Steinabschläge häuften sich um den Pfosten herum.
|
 |
 |
| Bei
der
Grabung Mitte der 90er
Jahre konnten viele Putzreste mit Fugenstrich, der sich im Sandboden
optimal erhalten hatte, ausgegraben werden. Das Fundmaterial belegt
aber auch, dass die Wände insgesamt leuchtend weiß
gekalkt
waren, so dass sich der rote Fugenstrich besonders markant abheben
konnte4).
Die aufgetragene Kalkschicht war
teilweise noch millimeterdick erhalten5).
Die nachgewiesene Frontlänge des Haupthauses, das zur nahen
Römerstraße hin orientiert war, beträgt 30
Meter. |
 |
 |
|
|
Schutzdach
|
  |
Die Steinsichtigkeit, wie sie ohne schützende (antike)
Putzschicht
bis zum Giebelansatz an der Westseite sichtbar war, nach
Möglichkeit zu erhalten, war allgemeines Bestreben vor Ort und
ein
besonderes Anliegen der Archäologie Mainz. Die Bedenken, die
aggressive Witterung werde das historische Mauerwerk auf Dauer
irreparabel schädigen, führte gegen erbitterten
Widerstand
von Herrn G. Rupprecht zu einem vorläufigen, bewusst
asymmetrisch konzipierten und mit modernen Materialien gestalteten
Vordach im Westen, das als vorläufige Maßnahme
gedacht,
über Jahre umstritten blieb. Eine jetzt wohl
endgültige
Lösung bedeutet die Verschlämmung, die unter dem
Auftrag noch
grob die Quaderstruktur erkennen lässt, vor allem das
römische Mauerwerk im Westen endgültig
schützen soll.
Als Lösung für die Südseite bleibt ein
Schutzdach. |
 |
Der Vorschlag von Herrn Dr. Precht, bei der
Gestaltung der Westfront formale Vorstellungen und Anschaulichkeit wie
die Forderung nach dauerhaftem Schutz und historischer
Authentizität in einem “Neuputz” nach
römischem
Vorbild, wie er z.B. im Archäologiepark Xanten umgesetzt
wurde, zu
vereinen, war angesichts des Konzeptes, nur den historischen Befund zu
dokumentieren und zu erhalten, nicht zu realisieren |
|
|
Aussengrabung
|

Den Befund feststellen, messen, zeichnen, notieren,
archäologischer Alltag auch für Herrn
Knöchlein, der die
Grabung östlich der Kapelle begleitete. |

Freigelegtes
Fundament |

Umfassend
heraus präparierte Steinstickung, der untersten Schicht eines
Mauerfundaments
|

Selbst dort, wo alte Fundamente
ausgehoben
waren, um das für den Nachfolgebau geeignete Material zu
erhalten,
hat der Boden die verfüllte Grube als aufschlussreiches
Dokument
erhalten.
|

Hinter
dem freigelegten Fundamant des östlichen Eckrisaliten zeichnet
sich die leere Fundamentgrube des Vorgängerbaus deutlich ab. |

Vor
dem Risalitfundament wird die Schicht
der
Steinabschläge für die Dokumentation
gesäubert. |

Hier liegt ein Hund (sorgfältig) begraben;
ein Bauopfer? |

Kurze
Siesta |

Der wenig qualitätsvolle Aufbau des Brunnenschachts deutet auf
eine Anlage in nachantiker Zeit hin. |
|